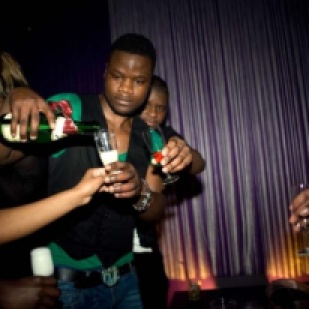Das Leben ist lebensgefährlich, hat Erich Kästner gesagt. Ist dieses Leben dann überhaupt lebenswert? Nur wenn man Vertrauen darin hat. Ein Essay.
Das Leben wäre unerträglich, würden wir in unserem Alltag nicht ein Mindestmaß an Vertrauen an den Tag legen. Wer anderen Menschen vertraut und daran glaubt, dass sie es gut mit einem meinen, lebt länger, haben Wissenschaftler herausgefunden. Voraussetzung dafür anderen vertrauen zu können, sei es, sich ihnen mit Hingabe zuwenden zu können. Wer sich hingibt, besitzt den Glauben darin, das andere es Wohlmeinen mit einem.
Um unseren Alltag zu meistern, benötigen wir natürlich nicht unbedingt den Glauben an Gott: Dafür brauchen in der Regel bloß einen gut geführten Terminkalender, weil unser Alltag automatisiert und auf Funktionalismus ausgerichtet ist wir vertrauen auf Rituale, wenn wir ins Auto steigen, Arbeiten gehen oder Freunde treffen; wir schnüren uns auf immer dieselbe Weise die Schuhe; wir essen immer zur gleichen Zeit zu Mittag; wir haben ein Ritual beim morgendlichen Aufstehen, den Tag zu beginnen. Warum tun wir dies alles auf die immer selbe Weise? Rituale fungieren in gewisser Weise als eine im Unbewussten wirkende Heimat, die eine Gefahrlosigkeit signalisierende Wiederholung von Taten gewährleisten und uns so Gewissheit und Sicherheit geben. Solange es auf diese Weise läuft, brauchen wir keine Führung, um durch den Tag zu kommen.
Begegnen wir aber Menschen, von denen unsere Entscheidungen im Alltag abhängig sind, bestimmt das Vertrauen das Zusammenspiel von Menschen. Dabei richten wir unseres nach der Glaubwürdigkeit desjenigen aus, der unsere Taten beeinflusst und von dem wir abhängen: Wie ehrlich wirkt dieser Mensch? Wie kenntnisreich erscheint er? Welches Ansehen hat die Person? Oder welche Autorität vermittelt sie? Vertrauen ist also gewissermaßen gleichzusetzen mit der Berechnung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein anderer eine Handlung ausführen wird, die zu unserem Nutzen ist, sodass wir in Erwägung ziehen, uns auf eine wie auch immer geartete Art von Kooperation mit ihm einzulassen.
Da es in der Natur des Menschen liegt, mit anderen zu koexistieren, kommt er nicht umhin mehr noch: es ist sogar existenziell für ihn vertrauen aufzubauen, um mit anderen zu kooperieren. Grundvoraussetzung für diese Art von Vertrauen ist Kommunikation, verbale sowie nonverbale. Aus den diversen Formen von Kommunikation entsteht subjektiv wahrgenommene Wirklichkeit, aus der wiederum Handlungen folgen.
Genau hier aber offenbart sich die Schnittstelle zum Gegenteil von Vertrauen, dem Misstrauen: In einer Kultur der totalen Kommunikation, wie der unseren, steckt auch immer das Dilemma der Inkommunikabilität, sagt der Soziologe und Philosoph Niklas Luhmann. Er meint: Alles Ausgesprochene trage auch das Verschwiegene in sich, das Ausgelassene, das Nichtgesagte. Der Pool an Nichtgesagtem, an fehlender Information also, ist im Moment der Kommunikation immer größer als die tatsächlich vermittelte Information. Das Potenzial für Misstrauen ist deshalb eigentlich immer gewaltiger als das für Vertrauen. Es ist demnach stets riskanter jemandem zu vertrauen als ihm zu misstrauen. Doch was wäre das Leben wert, würden wir Anderen stets eher misstrauen als vertrauen?
Deshalb vertrauen wir besser darauf, dass andere wie wir im Parkhaus auch bloß nach ihrem Auto suchen und nicht nach Opfern. Wir schlummern im Flugzeug ein, darauf vertrauend, dass unser Sitznachbar aus unserer Verwundbarkeit keinen Vorteil zieht. Wir legen die Sicherheit unserer Körper in die Hände von Ärzten und Apothekern, denen wir unsere Gesundheit anvertrauen. Als Kind vertrauen wir darauf, dass unsere Eltern uns keine vergiftete Nahrung auftischen. Lesen wir eine Zeitung, hören wir Radio oder schauen wir fern, gehen wir davon aus, dass die Journalisten ihre Berichte nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert haben und uns wahrheitsgemäß informieren.
Das Leben wäre nicht lebenswert, würden wir den Menschen kein Vertrauen entgegenbringen, die uns begegnen. Worum es also geht, ist nicht immer das explizite Wissen über eine Person oder einen Sachverhalt. Es geht darum ihm Vertrauen zu schenken und ihm zu glauben. Doch diese Frage muss bleiben: Ist dann Vertrauen eher Bedingung oder Ergebnis einer Kooperation?